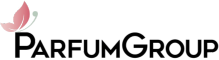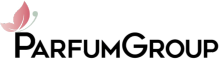Was für einen Einfluss üben die Düfte auf uns aus?
„Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als aller Worte Augenschein, Gefühl und Wille. Sie erfüllt uns vollkommen, es gibt kein Mittel gegen sie.“
Patrick Süßkind: „Das Parfüm“
Betäubend, verführerisch, sie lassen uns schwärmen, indem sie traumhafte Bilder vor unseren Augen entfalten; sie stimulieren die Sinne, beeinflussen unser Verhalten und Wohlbefinden, unsere Emotionen und Entscheidungen – so starke Überzeugungskraft steckt in den Düften, in den Parfüms, genau wie es Patrick Süßkind in seinem gleichnamigen Roman darstellt. Diese Kraft bewegt auch seine Hauptfigur zum Schaffen eines einzigartigen Parfüms, was sich in Hauptziel und Sinn ihres Lebens verwandelt. Er zeigt uns auch, wie das Leben wohl ausgesehen hätte, wenn man keinen Geruchssinn besäße. Denn der Geruchsinn ist etwas Eigenartiges, das die Menschheit in der vielen Jahren Evolution treu begleitet und beim Überleben geholfen hat.
Die Düfte, die wir durch den Geruchssinn wahrnehmen, sind eigentlich Emotionen, die in unseren Körper einströmen. Ob sie positiv oder negativ sind, hängt das von unseren Einstellungen und Erinnerungen ab, die wir mit dem jeweiligen Duft verknüpfen. Daher kann ein und derselbe Duft von zwei verschiedenen Personen gleichzeitig als positiv und negativ empfunden werden. So riecht der Sommer für einige nach frischer Wassermelone und für andere nach kühler Brise. Was verläuft aber eigentlich in unseren Körpern, besser gesagt in unseren Nasen oder am besten in unserem Gehirn, wenn wir einen Duft riechen?
Historischer Überblick
Das Riechen ist der älteste der menschlichen Sinne und genau dadurch hatte man in der Vergangenheit bessere Chancen zum Überleben. Im biologisch ältesten Gehirnteil gelegen erfüllte der Geruchssinn in der Frühzeit der Menschheit sehr wichtige Funktionen, und zwar warnte er vor Gefahr und half bei der Suche nach Nahrung und Wasser. Rein biologisch betrachtet dient der Geruchssinn in Wirklichkeit als Warnsinn, der mehr als 10 000 Duftnoten unterscheiden kann. Selbst der Angstschweiß bei anderen Menschen kann gerochen werden, was im Überlebenskampf besonders nützlich war.
Die Partnerwahl wird auch vom Geruchssinn und dem Geruch, den der andere versprüht, beeinflusst. „Die Chemie“ zwischen zwei Personen kann wörtlich auf den Geruch der beiden bezogen werden. Die menschliche Evolution hat dafür gesorgt, dass die Menschheit nicht aussterben könnte. Die Duftmoleküle, die ein Mensch absondert, tragen Information über die Beschaffenheit seines Erbgutes. In den Urzeiten noch suchte man nach einem starken Partner mit guten Genen, d.h. nach einem, der sein Immunsystem optimal ergänzen kann, um stärkeres und gesundes Nachkommen zu haben, mit besonders widerstandsfähigem Immunsystem.
Nach der Aufklärung entdeckte man, dass die menschliche Stimmung durch den Geruchssinn, also durch die gerochenen Düfte, beeinflusst werden konnte. Die Düfte begonnen zunehmend als Stimmungsmacher benutzt zu werden. Man verwöhnte dadurch die Sinne und rief in den Anderen die gewünschte Stimmung hervor, was zu den gewünschten Handlungen ihrerseits führte.
Was passiert in unserer Nase und unserem Gehirn, wenn wir einen Duft riechen?
Jedes Lebewesen auf der Erde, auch viele Gegenstände und Materialien haben ihren eigenen Geruch, der sehr komplex und aus mehreren Elementen zusammengesetzt ist. Beim Einatmen gelangen die Duftmoleküle zur Riechschleimhaut, die am oberen Ende der Nasenhöhle liegt. Da befinden sich zwischen 10 und 30 Millionen Riechnervenzellen, die sich alle vier bis sechs Wochen erneuern. Die Nervenzellen besitzen Rezeptoren für circa 400 verschiedene Duftstoffe. Wenn der Duft an die Rezeptoren gelangt, löst er in der Zelle einen elektrischen Impuls aus, der ans Gehirn, genauer gesagt ins limbische System, weitergeleitet wird. Das limbische System ist für die Verarbeitung von Geruchseindrücken und Emotionen verantwortlich. Hier werden auch die Triebe gelenkt. Wenn der Impuls das limbische System erreicht hat, erzeugt es sofort über die Duftinformation ein Gefühl – Freude, Angst, Ekel. So durch die direkte Weiterleitung an das limbische System wird Einfluss auf unsere Emotionen und Handlungen unterbewusst ausgeübt. Danach wird der Impuls in die Großhirnrinde weitergeschickt, wo der bewusste Geruchseindruck entsteht, d.h. der Duft wird hier erkannt. Nur wenige Duftsubstanzen sind genügend, um den Duft zu erkennen – die s.g. Leitsubstanzen. Ob wir den Duft mögen oder nicht, hängt von unserer Erfahrung damit ab.
Geruchsgedächtnis
Was für ein Gefühl im Kontakt mit einem Duft in uns hervorgerufen wird, hängt vom Geruchsgedächtnis ab. Die menschlichen Erinnerungen sind eng mit Düften und Gerüchen verknüpft. Der Geruchssinn ist noch bei den Neugeborenen komplett ausgereift, damit sich das Geruchsgedächtnis in den ersten drei Lebensjahren bilden kann. Wir kommen auf die Welt ohne angeborene Duftvorlieben, aber unsere weitere Entwicklung prägt unser Duftempfinden. Die Düfte sind immer mit guten oder schlechten Ereignissen verknüpft. Das Geruchsgedächtnis hat den Geruch und die dazu gehörende Emotion gespeichert. Daher unterscheiden wir zwischen angenehmen und unangenehmen Düften. So kann man durch einen Duft in der Situation zurückversetzt werden, in der man ihn zum ersten Mal gerochen hat. Das wird „Proust-Effekt“ genannt, nach dem französischen Autor Marcel Proust. Auf dieser Weise können wir uns an bestimmte Düfte erinnern und an die Emotionen, die sie in uns hervorrufen.
Die Wirkung der Düfte wird aber vom Vernunft nicht kontrolliert, das bedeutet, sie geschieht auf unterbewusster Ebene. Dieses Wissen ist der Wirtschaftswelt schon lange bekannt. Große Unternehmen in den USA mischen zum Beispiel in ihrer Klimaanlage verschiedene Duftstoffe, um die Motivation ihrer Mitarbeiter zu erhöhen, was auch zur Steigerung der Umsätze führt.
In Deutschland wurde ein Experiment in der Regionalbahn zwischen Augsburg und Lindau durchgeführt. Über die Klimaanlage wurde Duftmischung aus Jasmin, Rosenholz und Melone in einem Abteil versprüht. Diese Aromen sind für ihre beruhigende Wirkung bekannt. Nach dem Ende der Fahrt befragte man die Insassen, wie sie sie fanden. Das Ergebnis war eindeutig – diese aus dem duftenden Abteil bewerteten die Fahrt wessentlich besser als die anderen aus den nicht duftenden Abteilen.
Viele Kaufhäuser, Hotels, Supermarktketten machen auch vom diesem Wissen Gebrauch, um ihre Kunden zum Geldausgeben zu locken, weil wer sich wohl fühlt und positiv gestimmt ist, kommt bestimmt wieder.
Am Ende können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass wir nicht mit der Nase, sondern mit dem Gehirn riechen. Vielleicht deswegen gelingt es der Haupfigur von Patrick Süßkind letzten Endes, das Universalparfüm zu schaffen. Raten können wir nur, da es nähmlich noch so vieles gibt, was diesbezüglich erforscht werden kann, und zwar mit der Nase! ïŠ